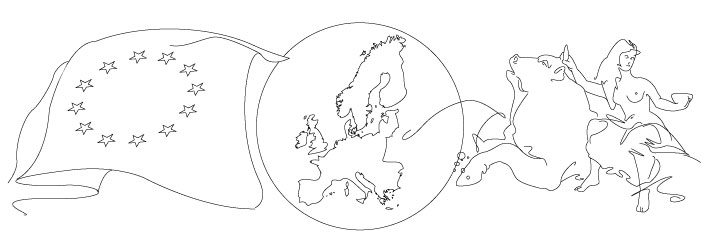 Zwei kurze Antworten, bevor wir ins Detail gehen: Erstens, weil die Materie so kompliziert ist. Und zweitens, weil sich die Beteiligten uneins darüber sind, wohin die Reise gehen soll.
Zwei kurze Antworten, bevor wir ins Detail gehen: Erstens, weil die Materie so kompliziert ist. Und zweitens, weil sich die Beteiligten uneins darüber sind, wohin die Reise gehen soll.
Mit der Bankenunion wollen die Mitglieder der Eurozone eine Wiederholung der Finanzkrise von 2009 verhindern, als marode Banken ihre Heimatstaaten in den Abgrund zogen, wie das in Irland und Spanien der Fall war. Anders als gemeinhin angenommen waren die beiden Länder zu Beginn der Krise gar nicht überschuldet – der spanische Staatshaushalt galt damals sogar als besonders solide. Doch dann wurde aus der spanischen und irischen Banken- eine Trümmerlandschaft, Madrid und Dublin mussten mit Steuergeld beistehen und hatten wenig später eine eigene Schuldenkrise am Hals. Die Bankenunion soll genau diese Kettenreaktion unterbinden.
Damit sie funktioniert, braucht diese Union drei Standbeine: Eine zentrale Aufsichtsbehörde, ein Regelwerk zur möglichst schmerzlosen Abwicklung maroder Banken, sowie eine europäische Einlagensicherung, die dafür sorgen soll, dass kleine Sparer im Notfall nicht ihre Vermögen verlieren. Der erste Eckpfeiler ist bereits aufgestellt: Mit der Aufsicht über die 200 größten Banken der Währungsunion wurde eine neue, bei der Europäischen Zentralbank in Frankfurt angesiedelte Behörde betraut, die ihre Arbeit im kommenden Jahr aufnehmen soll – zumindest in der Theorie. Dieser Nachsatz ist notwendig, weil die zwei anderen Pfeiler ebenfalls stehen müssen, bevor es losgehen kann.
Über das zweite Standbein gibt es seit dem Treffen der EU-Finanzminister vergangene Woche eine prinzipielle Einigung. Der so genannte Abwicklungsmechanismus sieht vor, dass bei der erzwungenen Schließung einer überschuldeten Bank fortan auch die Eigentümer und Gläubiger des Instituts (damit sind die Inhaber von Anleihen und großen Konten gemeint) zur Kasse gebeten werden: Gemäß dem Vorschlag sollen sie auf jeden Fall die ersten acht Prozent des Finanzlochs stopfen – und unter Umständen auch mehr, sollte sich dieses Loch als besonders tief erweisen. Klingt logisch, ist aber revolutionär – denn in Irland mussten nicht die Eigentümer und Gläubiger bluten, sondern die Steuerzahler. Erst die Bankenkrise in Zypern im März 2013 brachte ein Umdenken.
Ob der Abwicklungsmechanismus in dieser Form auch wirklich steht, ist aber noch nicht klar, denn auch das Europaparlament muss zustimmen. Und die Abgeordneten sehen noch Änderungsbedarf – sie wünschen sich beispielsweise, dass die EU-Banken mehr in einen gemeinsamen Hilfsfonds einzahlen, als es derzeit vorgesehen ist. Eine Entscheidung sollte bis Jahresende fallen.
Zu guter Letzt die Einlagensicherung. Hier wird die Sache hochpolitisch – wir kommen zur zweiten Antwort auf die Frage. Denn eine gemeinsame Einlagensicherung bedeutet, dass im Notfall deutsche Beiträge zur Rettung spanischer Sparer eingesetzt werden. Und in Berlin will man davon nichts hören – zumindest vorerst, denn nach der Bundestagswahl im September könnte die Welt ganz anders aussehen. Fortsetzung folgt.
